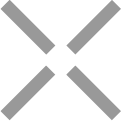
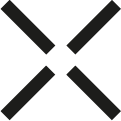
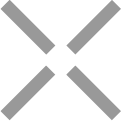
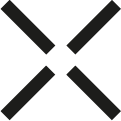

21.01.2021
Jede Minute ist damit zu rechnen, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) verkündet und ihr damit Rechtswirksamkeit gibt. Bisher ist sie „nur“ im finalen Entwurf auf der Webseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) verfügbar (unter: https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html).
Auch nach diesem Entwurf wird die Corona-ArbSchV nicht sofort in Kraft treten, sondern verzögert 5 Tage nach ihrer Verkündung. Arbeitgeber haben mithin diese 5 Tage Zeit, die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
Wird die Corona-ArbSchV beispielsweise heute, am 21.01.2021, verkündet, so würde sie zum 27.01.2021 in Kraft treten. Außerkrafttreten soll sie am 15.03.2021, sofern nicht bis dahin eine Verlängerung durch eine weitere Rechtsverordnung erfolgt.
Fragen, die Arbeitgeber aktuell umtreiben bzw. umtreiben müssen, sind:
Zu (1):
Bereits der Wortlaut der Regelung macht deutlich, dass Arbeitgeber einseitig Home Office anbieten müssen, aber keine Verpflichtung der Beschäftigten zur Annahme des Angebots existiert.
Doch welche Vorgaben macht die maßgebliche Regelung von § 2 Abs. 4 Corona-ArbSchV selbst, was die Verpflichtung des Arbeitgebers betrifft? Der Wortlaut der Vorschrift bietet zumindest erste Ansatzpunkte:
„Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen.“
Die Pflicht zum Angebot von Home Office betrifft demnach nur Beschäftigte, die ihre Arbeitsleistung in Form von Büroarbeit erbringen. Personen, deren arbeitsvertraglich geschuldete Leistung in einer anderen Form von Arbeit besteht (z.B. Paketzusteller), haben bereits keinen Anspruch auf Home Office nach § 2 Abs. 4 Corona-ArbSchV.
Auch ist der Anspruch auf Home Office ausgeschlossen sein, wenn zwingende betriebsbedingte Gründe der Erfüllung des Anspruchs entgegenstehen.
Ein einklagbares Recht des Arbeitnehmers schafft § 2 Abs. 4 Corona-ArbSchV nicht. Allerdings muss der Arbeitgeber dann – dies auch dokumentiert – begründen, dass zwingende betriebliche Gründe gegen das Anliegen des Beschäftigten sprechen. Folglich trägt der Arbeitgeber die Begründungs- und Nachweislast.
Nach Ansicht des BMAS, so geäußert in seinen FAQ (verfügbar unter dem genannten Link), können zwingend betriebsbedingte Gründe beispielsweise sein:
Daneben kommen aber auch technische und organisatorische Gründe in Betracht, z.B.
sowie
Die FAQ formulieren eher nebulös, aber gleichzeitig fordernd, dass diese Gründe jedoch nur eingeschränkt und bis zur Beseitigung des entsprechenden Hinderungsgrundes dem Anspruch auf Home Office entgegengehalten werden könnten. Insbesondere lässt sich darüber streiten, welche Maßnahmen zu welchen finanziellen Kosten und innerhalb welchen Zeitraums ein Arbeitgeber treffen muss.
Es obliegt den Landesbehörden, die das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) anwenden, zu prüfen, ob der Arbeitgeber das Home Office rechtmäßig verweigert hat oder nicht. Dazu haben die Behörden insbesondere Auskunftsansprüche, weshalb der Arbeitgeber seine versagenden Entscheidungen dokumentieren sollte.
Setzt der Arbeitgeber eine Verpflichtung zur Gewährung von Home Office oder andere Schutzmaßnahmen (dazu unter (2)) nicht oder nur unzureichend um, stehen der zuständigen Behörde folgende Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung:
Zu (2):
Allgemein hat der Arbeitgeber eine Prüfpflicht nach § 2 Abs. 1 Corona-ArbSchV, die im Ausgangspunkt die Gefährdungsbeurteilung nach §§ 5 f. Corona-ArbSchV beinhaltet. Daran anschließend sieht § 2 Abs. 2 Corona-ArbSchV vor, dass der Arbeitgeber geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen hat, um betriebsbedingte Personenkontakte zu reduzieren. Die Regelung zielt damit auf die Verhältnisse im Betrieb ab, in dem die Arbeitnehmer eingesetzt werden.
Hinsichtlich der Nutzung von Räumen durch mehrere Personen macht ihm § 2 Abs. 5 Corona-ArbSchV weitere Vorgaben: Jede Person soll einen räumlichen Bereich von 10 Quadratmetern für sich zur Verfügung haben. Geben die räumlichen Gegebenheiten diese Möglichkeit nicht her, so muss der Arbeitgeber vergleichbare Maßnahmen nach § 2 Abs. 3 S. 2 Corona-ArbSchV ergreifen (s. § 2 Abs. 5 S. 2 Corona-ArbSchV).
Bei größeren Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten gilt zudem ein Gebot der Einteilung in kleine Arbeitsgruppen (vgl. § 2 Abs. 6 Corona-ArbSchV), wobei eine Durchmischung der Gruppen nicht erfolgen darf.
Der Arbeitgeber hat ferner medizinische Gesichtsmasken oder Atemschutzmasken (FFP2-Masken) zur Verfügung zu stellen, wenn sich in einem Raum mehr als eine Person pro zehn Quadratmetern länger aufhält, der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann oder bei Tätigkeiten mit Gefährdung durch erhöhten Aerosolausstoß zu rechnen ist, z.B. weil sehr laut gesprochen werden muss (dazu § 3 Corona-ArbSchV).
Fazit
Alles in allem bleibt die Corona-Arbeitsschutzverordnung weit hinter dem ersten Entwurf zurück. Nichtsdestotrotz empfehlen wir allen Arbeitgebern, die Möglichkeit der Arbeit aus dem häuslichen Umfeld im Einzelfall zu prüfen und die Entscheidung zu dokumentieren.